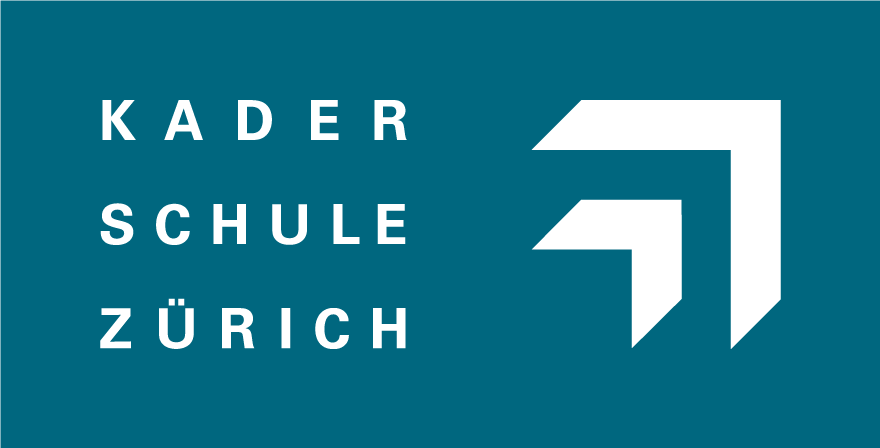Kursdetailansicht - Grundlagen des Rechts
Module
1. 1. Grundlagen des Rechts
Das Zusammenleben in einer Gesellschaft ist komplex. Wo immer zwei Menschen aufeinandertreffen, stehen sich unterschiedliche Wertvorstellungen, Meinungen und Interessen gegenüber. In der Familie, in der Ehe, in der Schule, bei der Arbeit, beim Einkauf, bei der Wohnungsmiete, im Strassenverkehr – überall kann es zu Konflikten kommen. Damit das Zusammenleben funktioniert, braucht es Regeln, die dem Einzelnen eine Orientierung geben, wie er sich verhalten soll. Aber nicht nur die Beziehungen der Bürgerinnen und Bürger untereinander müssen geregelt werden, auch das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat bedarf einer Ordnung. Hierbei stellt das Recht eine unabdingbare Grundlage dar, indem es verbindliche Verhaltensregeln für alle Beteiligten vorgibt.
Kapitel
2. 2. Das ZGB/OR
Das Privatrecht befasst sich mit dem Verhältnis der einzelnen Bürgerinnen und Bürger untereinander. Die wichtigste privatrechtliche Kodifikation ist das schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB). Es gliedert sich in zwei Teile, in das Zivilgesetzbuch (ZGB) und in das Obligationenrecht (OR). Das OR ist formell gesehen ein Teil des ZGB, wird aber in der Systematik als eigenes Gesetzbuch behandelt. Darum spricht man auch vom ZGB/OR.
Das ZGB wurde von Eugen Huber im Auftrag des Bundesrats entwickelt und im Jahre 1907 vollendet. Es trat im Jahre 1912 in Kraft.
Kapitel
3. 3. Personenrecht
Das Personenrecht ist im ersten Teil des ZGB geregelt (Art. 11 - 89c ZGB). Das Personenrecht befasst sich mit Personen, dass heisst mit Rechtssubjekten. Das Personenrecht regelt, wer im Privatrecht Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Zudem regelt das Personenrecht, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang Rechtssubjekte Rechte und Pflichten erwerben können und wie der Schutz ihrer Persönlichkeit gewährleistet ist.
Kapitel
4. 4. Familienrecht
Das Familienrecht ist im zweiten Teil des ZGB geregelt. Das Familienrecht regelt die Rechtsverhältnisse innerhalb der Familie. Dazu gehören das Eherecht (Eheschliessung, Scheidung, Wirkungen der Ehe, eheliches Güterrecht), das Verwandtschaftsrecht (Entstehung und Wirkungen des Kindesverhältnisses, persönliche und wirtschaftliche Folgen der Familiengemeinschaft) sowie das Erwachsenenschutzrecht. Auf Letzteres wird im Rahmen der folgenden Ausführungen nicht eingegangen.
Kapitel
5. 5. Erbrecht
Das Erbrecht ist im vierten Teil des ZGB geregelt. Das Erbrecht umfasst alle Rechtsnormen, die die vermögensrechtlichen Folgen des Todes eines Menschen regeln. Es sagt, wie das Vermögen eines Verstorbenen auf die Erben zu verteilen ist. Das eheliche Güterrecht und damit die güterrechtliche Auseinandersetzung geht der erbrechtlichen Auseinandersetzung vor und regelt die Aufteilung des Vermögens auf beide Ehegatten.
Kapitel
6. 6. Sachenrecht
Das Sachenrecht ist im vierten Teil des ZGB geregelt. Es behandelt das Eigentum an Sachen, die beschränkt dinglichen Rechte sowie den Besitz und das Grundbuch. Es bildet zusammen mit dem Immaterialgüterrecht und dem Obligationenrecht das sogenannte Vermögensrecht.
Kapitel
7. 7. Allgemeine Vertragslehre
Das Obligationenrecht (OR) ist der 5. Teil des ZGB und somit formell gesehen ein Teil des ZGB, wird aber in der Systematik als eigenes Gesetzbuch behandelt. Es gliedert sich in einen allgemeinen Teil (OR AT) und einen besonderen Teil (OR BT). Der allgemeine Teil (Art. 1 - 183 OR) enthält Regeln, die für sämtliche Verträge gelten. Im besonderen Teil (Art. 184 ff. OR) werden einzelne Vertragsverhältnisse wie z.B. der Kaufvertrag, die Miete oder der Arbeitsvertrag geregelt.
Kapitel
8. 8. Kaufvertrag
Der Kaufvertrag ist im 6. Titel des OR geregelt. Wenn diese besonderen Artikel auf eine bestimmte Frage keine Auskunft geben, so sind die allgemeinen Bestimmungen über Vertrag und Obligation (1. bis 5. Titel) anzuwenden. Dabei gilt der Grundsatz, dass die besonderen Bestimmungen (also jene über den Kaufvertrag) den allgemeinen vorgehen, d. h. stärker sind. In erster Linie massgebend sind jedoch – ausgenommen bei zwingenden Gesetzesbestimmungen – die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien, da das Vertragsrecht vorwiegend ergänzendes (dispositives) Recht ist.
Kapitel
9. 9. Mietvertrag
Der Mietvertrag gehört zu den sogenannten Verträgen auf Gebrauchsüberlassung. Bei dieser Art von Verträgen wird eine Sache oder ein Recht dem Vertragspartner für eine bestimmte Zeitdauer zum Gebrauch überlassen. Am Ende der Vertragsdauer muss der Vertragsgegenstand zurückgegeben werden. Zu den Verträgen auf Gebrauchsüberlassungen zählen neben dem Mietvertrag auch der Pachtvertrag, der Gebrauchsleihevertrag sowie der Darlehensvertrag.
Kapitel
10. 10. Einzelarbeitsvertrag
Die Arbeitsleistungen, die in der Praxis im Rahmen verschiedener Berufe erbracht werden, lassen sich unterschiedlichen Vertragsarten zuordnen. Das Obligationenrecht unterscheidet zwischen dem Arbeitsvertrag, dem Werkvertrag und dem Auftrag.
Kapitel
11. 11. Unternehmensformen
Im alltäglichen Leben werden wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche (sogenannte ideelle) Ziele sowohl von Einzelpersonen als auch von Personengruppen verfolgt. Oft schliessen sich Personen zusammen, um gemeinsam ein Ziel zu verfolgen – insbesondere, wenn es sich dabei um grössere Vorhaben handelt, die die finanziellen und arbeitskräftemässigen Ressourcen einer einzelnen Person übersteigen. Die verschiedenen Unternehmensformen stellen für diese Rechtsverhältnisse geeignete Organisationsformen und die entsprechenden konkreten Regelungen zur Verfügung.
Die Gestaltung des Namens von kaufmännischen Unternehmen wird durch das Firmenrecht, Informationen über die grundlegenden rechtlichen Verhältnisse von kaufmännischen Unternehmen, werden durch das Handelsregister geregelt.
Kapitel
12. 12. Strafrecht
Zur Regelung des Zusammenlebens der Menschen stellt das Recht Verhaltensvorschriften (Verbote und Gebote) auf, deren Einhaltung der Staat wenn nötig mit Zwang durchsetzt. Wenn eine Norm verletzt worden ist, so lässt sich dies zwar nicht mehr rückgängig machen, doch darf der Staat die Missachtung des Gesetzes nicht hinnehmen. Um die Verbindlichkeit der Rechtsordnung zu bewahren, muss die Verletzung einer Norm nachteilige Folgen für die verursachende Person bzw. für die verursachenden Personen haben.
Kapitel
13. 13. Grundrechte (Einschränkung von Freiheitsrechten)
Grundrechte sind von der Bundesverfassung und von internationalen Menschenrechtskonventionen garantierte fundamentale Rechte, die dem Einzelnen gegenüber dem Staat zustehen. In diesem Modul geht es vorwiegend um die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Staat Grundrechte der Bürger, insbesondere Freiheitsrechte, (rechtmässig) einschränken darf.
Kapitel
14. 14. Haftpflichtrecht
Eines der wichtigsten Gebiete des Zivilrechts ist das Haftpflichtrecht und hat das Einstehenmüssen eines Schadens zum Gegenstand. Haftungstatbestände ergeben sich aus vertraglicher Haftung und aus ausservertraglicher Haftung (Haftung aus unerlaubter Handlung). Diese Modul befasst sich mit der ausservertraglichen Haftung, welche in OR 41 ff., in gesetzlichen Bestimmungen des ZGB (z.B. Art. 333 ZGB) und in Spezialgesetzen (z.B. Art. 58 SVG) geregelt ist. Eine grosse Rolle im ausservertraglichen Haftpflichtrecht spielt auch die Judikatur (Gerichtsurteile).
Kapitel
15. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG)
In diesem Modul lernen Sie, wie Geldforderungen und Forderungen auf Sicherheitsleistungen auf dem Weg der Schuldbetreibung durchgesetzt werden. Das entsprechende Verfahren ist im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) geregelt.